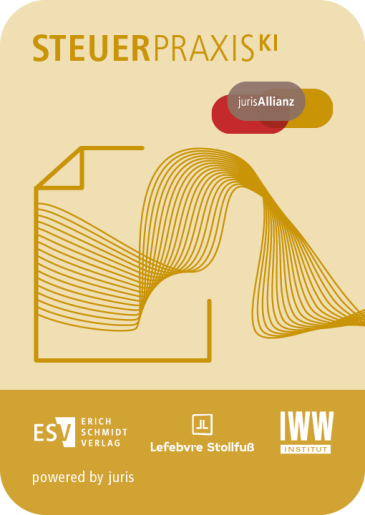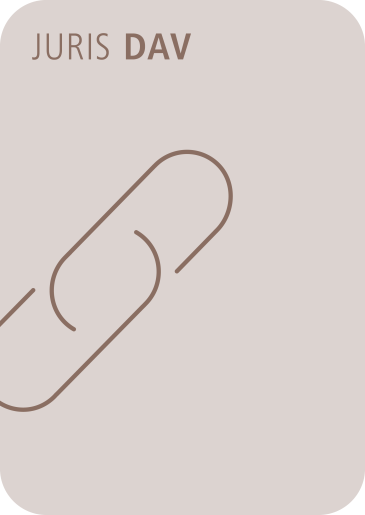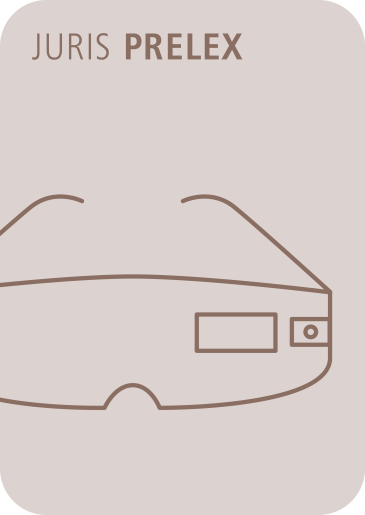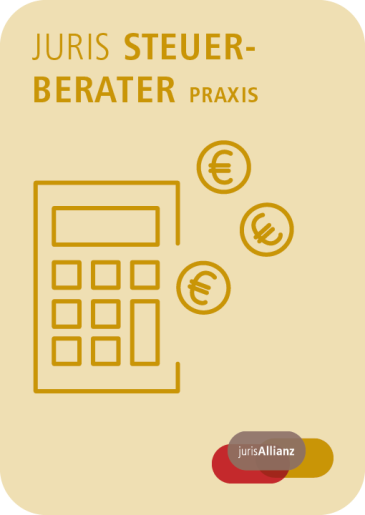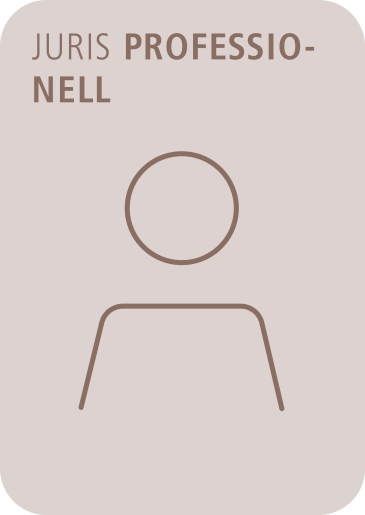Effizienter recherchieren
Haben Sie immer und überall Zugriff auf die juristischen Inhalte, die Sie benötigen. juris ist das führende Online-Portal für Rechts- und Praxiswissen in Deutschland. Unser Produktportfolio umfasst sowohl übergreifende Inhalte wie Gesetze und Rechtsprechung als auch spezifische Lösungen und eine verlagsübergreifende Auswahl an Fachliteratur für Ihr individuelles Fachgebiet – immer aktuell, inhaltlich zuverlässig und intelligent vernetzt. Mit dem Rechts- und Praxiswissensmanagement von juris arbeiten Sie effizienter. Dank Wissen, das für Sie arbeitet.
Passende Lösungen für Ihre Branche
juris bietet Ihnen sowohl rechtsgebietsübergreifende Wissensmanagementlösungen als auch anwendungsorientierte Produkte für spezifische Fachgebiete. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im direkten Austausch mit Kunden aus allen Bereichen der Rechtspraxis und entdecken Sie jetzt das für Sie passende Produkt.
Services
Lassen Sie sich von unseren Recherche-Experten unterstützen und buchen Sie kostenfreie Online-Schulungen oder Schulungen vor Ort, um das juris Portal noch einfacher und effizienter zu nutzen.
Schulungen vor Ort Online SchulungenSie kennen juris noch nicht?
Dann verschaffen Sie sich in dem folgenden 4-minütigen Video gerne einen ersten Eindruck von der Funktionsweise des juris Portals. Lernen Sie jetzt das Rechts- und Praxiswissensmanagement der Zukunft kennen.